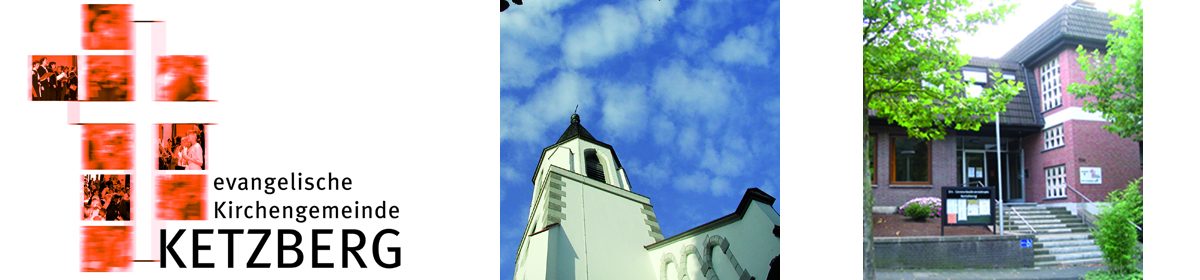Gerhard Tersteegen trägt einen aus den Niederlanden stammenden Namen Gerrit ter Steegen, wie der Torhüter der deutschen Fußballnationalmannschaft. Gerhard Tersteegen wurde 1697 geboren im niederrheinischen Moers als Sohn eines reformierten Kaufmanns. Moers gehörte damals zum Oranischen Reich.
Er besuchte ab 1703, also mit 6 Jahren die Lateinschule Adolfinum und lernte Hebräisch, Griechisch, Latein. Der Vater starb im selben Jahr. Die Mutter konnte Gerhard nach der Schule kein Theologiestudium bezahlen, also machte Tersteegen bei einem Verwandten in Mülheim an der Ruhr eine Lehre zum Kaufmann, mit 15. Zwei Jahre war Tersteegen als Kaufmann tätig- dann zog er sich in die Stille zurück. Er hatte eine Erweckung erlebt. Er war in einen christlichen Kreis aufgenommen worden. Er war reformiert geprägt, Glaube und Bibel waren ihm wichtig, die Vorstellung, Eigentum Gottes zu sein. Zugleich war er pietistisch geprägt, betonte den persönlichen Glauben nach einem willentlichen Entschluss, eine Liebe zu Jesus und den Glaube an die Erlösung durch Jesus am Kreuz. Tersteegen machte es schriftlich: In einem Blutbrief dokumentierte er seine persönliche Bekehrung. Statt Tinte benutzte er sein eigenes Blut.
„Blut ist ein besonderer Saft“ – Anders als später in Goethes Faust schrieb er mit seinem Blut keinen Pakt mit dem Teufel, sondern verschrieb sich Jesus. Dieser Blutbrief entstand am Gründonnerstag 1724, da war er 26 Jahren alt:
„Meinem Jesu! Ich verschreibe mich Dir, meinem einigen Heÿlande und Bräutigam Christo Jesu, zu Deinem völligen und ewigen Eigenthum. Ich will Dein seyn, und bleiben, so lang ich lebe, und auch nach meinem Tod. Du sollst mein Herr und Haupt seyn, und ich Dein unwürdigstes Glied. Nichts soll mir mehr werth seyn, als Deine Ehre und Dein Wohlgefallen. Ich will Dir gehorsam seyn, und Deinem Willen nachleben, so gut ich kann. Ich will Dein seyn, und bleiben, in Zeit und Ewigkeit. Amen.“
Eine Selbstverpflichtung, stürmisch und radikal. Und durchzogen von biblischen Motiven: Haupt und Glied, Gehorsam und Willen, Herr und Haupt, Leben und Tod. Mit einer Formulierung aus dem Heidelberger Katechismus verschrieb er sich zum Eigentum Christi: ich will dein sein.
Tersteegen als Mystiker
Reformierter, radikaler Pietist mit einer Distanz zu Kirche und Welt – so kann man ihn beschreiben. Das Leben stellte er sich so vor, dass man durch Bekehrung zu Jesus einen Weg geht, der wie eine Pilgerreise durchs Leben ist. Das Ziel ist die Ewigkeit nach dem eigenen Tod. Bis dahin hält man sich von weltlichen Dingen fern, sie sind Ballast. Man lebt bescheiden und still, betet viel und tut dem Nächsten Gutes. Bei allem konzentriert man sich auf Jesus. In der Gemeinschaft Gleichgesinnter geht das besser. Man lernt voneinander, auch von Beispielen christlicher Menschen, wobei deren Konfession nicht so wichtig ist. Wichtig ist, dass sie innerlich ganz bei Jesus sind. Das ist Mystik , eine innerliche Verbindung zu Gott, bei der die Grenzen fließen: „Ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehn und finden“ (Gott ist gegenwärtig, EG 165,5). Man selbst wird unwichtig, die Vereinigung mit Gott ist der größte Genuss.
Tersteegen verdiente seinen Lebensunterhalt als Leineweber, später Bandwirker – in vorindustrieller Zeit ein Handwerk, das sich gut zu Hause erledigen ließ: mit einem Webrahmen Bänder flechten. Arbeiten, Gebetszeiten und Zeiten des Studiums sowie des Schreibens wechselten sich ab.
Er lebte ehelos und über 44 Jahre mit seinem Freund und Glaubensbruder Heinrich Sommer, ebenfalls Bandwirker in einem Haus auf dem Mülheimer Kirchenhügel, das im Krieg nicht zerstört wurde und heute Heimatmuseum ist. Die nahe Petrikirche besuchte er nicht, dafür die wöchentlichen Erbauungsstunden eines von der reformierten Kirche abgewiesenen Kandidaten der Theologie, Wilhelm Hoffmann. Tersteegen übernahm Aufgaben und nach dem Tod des Leiters die Leitung. Tersteegen wirkte als Autor religiöser Schriften, Laienprediger und Lieddichter, als Übersetzer und Vermittler von spanischer, französischer und niederländischer Mystik.
Tersteegen als Dichter und Seelenführer
Die Liedersammlung „Geistliches Blumengärtlein Inniger Seelen“ aus dem Jahr 1729 ist Tersteegens am weitesten verbreitete Schrift – sie enthält viele Lieder und Gedichte.
Zu Solingen hatte Tersteegen persönliche Kontakte. Einige seiner Werke wurden von Solinger Verlegern und Buchbindern gedruckt. ein Exemplar mit dem Titel „Brosamen“ aus der Zeit kann ich Ihnen zeigen. In Solingen hatte er Kontakt zu zwei Pfarrern und zu dem Verleger Peter Daniel Schmitz, der seine Schriften druckte. Es gab in Solingen Gruppen, die seine Erbauungsreden lasen und die er immer wieder auch einmal besuchte.
Tersteegen stand mit vielen Menschen im Briefwechsel. Als Seelsorger sprach er seine Adressaten an, manchmal wie ein Therapeut von Schwermütigen. In Mülheim gab er Erfahrungen mit Medizin und Heilkräutern an Kranke weiter. In seinem Nachlass war eine Laborausstattung.
Er selbst erkrankte an Wassersucht und starb 1769 in Mülheim an der Ruhr. Dort ist sein Grab an der Petrikirche, das Mülheimer Heimatmuseum dort ist heute das Tersteegenhaus.
Schon zu Lebzeiten gab es Freundeskreise im Bergischen Land, im Siegerland und in Krefeld. In Heiligenhaus gab es ein Gebäude, wo sich ein Freundeskreis immer wieder auch mit Tersteegen traf, eine kleine evangelische Kommunität: die Pilgerhütte Otterbeck. Unter Tersteegens Anleitung führten 8 Brüder ein gemeinsames Einsiedlerleben, ebenfalls als Weber. Tersteegen übernachtete dort auf seinen Reisen von Mülheim nach Elberfeld. Das Haus wurde im 19.Jahrhundert von Gruppen der Gemeinschaftsbewegung genutzt, aber 1969 für eine Straße zwischen Mülheim und Elberfeld abgerissen.
Eines der Zimmer in der Otterbeck wurde natürlich „Tersteegenzimmer“ genannt. Es gab auch in Mülheim ein Ausflugslokal, das „Tersteegensruh“ hieß. Es gab also nach seinem Tod eine gewisse Verehrung, die er selbst höchtswahrscheinlich befremdlich und unpassend gefunden hätte.
Tersteegens Lieder sind in evangelischen und freikirchlichen Liederbüchern, zwei auch im katholischen Gotteslob. Eine echte Perle ist ein Abend-, besser Nachtlied. Schlaflos durch die Nacht, das hört sich bei Tersteegen so an:
Liedvortrag EG 480 Nun schläfet man
Was nehmen wir von Tersteegen heute mit?
1. Der persönliche Glaube – mehr als ein nur formaler Glaube kann eine emotionale, persönlichen Aneignung des Glaubens einen Menschen prägen. Der Glaube durchdringt den Menschen. Es ist wie ein Liebesverhältnis, vertraut und sehnsüchtig zugleich. Persönlichkeit und Glaube berühren einander. Das ist pietistisch gedacht, passt zu dem Individualismus, der bis heute vielen wichtig ist.
Im Abendmahl, das wir in diesem Gottesdienst feiern, können wir und auch individuell angesprochen erleben, wir können mit unseren Sinnen schmecken und sehen, wie freundlich Gott ist.
2. Die Stille: Tersteegen hat zwar viel gedichtet und veröffentlicht: er war aber kritisch gegenüber allem Geschwätz. Auch gegenüber frommem Gerede: Dann lieber still werden, schweigen. Absehen von eigenen, noch so klugen Gedanken. Stille und Schweigen erleben heute viele Menschen beim Yoga. Immer geht es darum, zur Ruhe zu kommen, sich nicht ablenken zu lassen und andere nicht abzulenken.
3. Die Welt, von der Tersteegen sich abwendete, war von Feudalherrschaft geprägt. Das von Adligen Damen im Barock-Stil ausgestattete Kloster Saarn, der Preußen-König Friedrich II mit seinem Schloss Sanssouci– all das war Tersteegen zu aufgesetzt, vielleicht auch zu weit weg von den Sorgen derer, denen er als Seelsorger nah war. Tersteegen empfahl eine Abkehr von weltlichen Dingen. Was Tersteegen meinte, was ja keine Abkehr von den Nöten der Welt – als Seelsorger und Heiler war er diesem Teil der Welt sehr zugewandt. Gleichzeitig wendete er sich von weltlichem und kirchlichem Machtstreben ab, von oberflächlichem Schnickschnack. Wir würden das heute Achtsamkeit nennen. Sich fokussieren, nicht ablenken lassen von Dauernews, Social media und dem krampfhaften Streben nach Geld und Ansehen. Tersteegen sah und wusste besseres: Es soll nur Jesus sein. Tersteegen rät dazu, von sich selbst abzusehen. Als Seelsorger wird er dem Grübler empfehlen, von seinem Grübeln abzusehen, dem Zweifler von seinem Zweifel, dem, der wieder und wieder den Sinn sucht und nicht findet, rät er, von dieser quälenden Beschäftigung mit sich abzusehen – und nur auf Jesus zu sehen.
4. Eine kritische Bemerkung: Tersteegen macht sich selbst zuweilen sehr klein und spricht für heutige Ohren mit unangemessener Abwertung: Ich bin ein Wurm – auch das ist zwar biblisch, aber viele haben damit ja das Problem, dass sie sich selbst immer schon viel zu klein machen: unwürdig, geringschätzig und abwertend. Das ist auch ein Problem, und wir sollten nicht mit Tersteegen kritiklos einstimmen in eine Selbstzerknirschung, die nicht passt zu der Macht der Liebe, die uns Menschen doch gilt.
Also: ein bisschen mehr Tersteegen wagen: das heißt : mehr Gemeinschaft wagen. Mehr Kontakt wagen, mehr Zuwendung zu anderen wagen, Zuwendung zulassen. Mehr Ökumene wagen. Und: Konzentration auf das Wesentliche wagen, sich fokussieren.
Den Sinn nicht dauern ergrübeln, sondern außerhalb von sich selbst entdecken: „es soll nur Jesus sein“. Dann sortieren sich die anderen Lebensbereiche.
Mehr Tersteegen wagen heißt auch, der Liebe im Glauben mehr Raum geben, den Glauben als eine große Liebesgeschichte sehen, die Bibel als Liebesbrief. Dann wird anderes, irdisches, vergängliches, verlierbares weniger wichtig. Die Liebe hört niemals auf. Amen.
gehalten am 27.07.2025 von Pfarrer Christof Bleckmann

Fotos: www.gemeindebrief.de