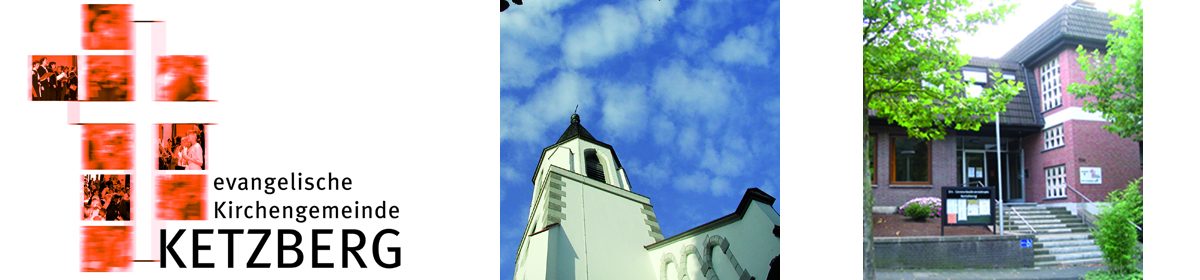Mehr als 15 Jahre wohne ich auf der Melanchthonstraße und zu meiner Schande hat es bis zur diesjährigen Sommerreihe gedauert, mich näher mit dem Reformator zu beschäftigen. Und was soll ich sagen?! Es hat sich gelohnt.
Ich habe einen weltoffenen, humanistisch geprägten Mann kennengelernt, der ein hohes Maß an Dialogfähigkeit besaß und dem bei aller Fähigkeit zum theologischen Abstrahieren das Staunen über Gott nicht verloren ging. In der Einleitung zu seinem ersten theologischen Lehrbuch – des ersten evangelischen überhaupt – schrieb er: Die Geheimnisse der Gottheit sollten wir lieber anbeten als erforschen. Aber er hieß von Haus aus hieß gar nicht Melanchthon.
Am 16. Februar 1497, noch so eben im Mittelalter, wird er als Philipp Schwarzerdt in Bretten geboren. Damals Grenzstadt zwischen der Pfalz und Baden, ist der 2.000 Seelenort immer wieder Begehrlichkeiten ausgesetzt. Und so muss Philip schon im Alter von sieben Jahren erleben, wie seine Heimatstadt zwei Wochen lang vom württembergischen Herzog belagert wird. Den Vater verliert er bereits mit 11 Jahren. Das ständige Hantieren des kurfürstlichen Rüstmeisters mit giftigen Materialien haben wohl eine schleichende Vergiftung ausgelöst. Wieder ist es der Krieg, wenn auch indirekt, der die Lebenswelt des Kindes aus den Fugen geraten lässt.
Diese Erlebnisse haben Philipp geprägt. Die Kriegsangst wird er zeit seines Lebens nicht mehr los. Immer wird er um Ausgleich bemüht sein.
Nach dem Tod des Vaters schickt die Familie ihn in eine angesehene Lateinschule nach Pforzheim. Und wie es manchmal so geht. Philipp wohnt bei einer entfernten Verwandten, die wiederum ist die Schwester von Johannes Reuchlin, eines bedeutenden humanistischen Gelehrten. Und so kommt es zur Begegnung mit dem Humanismus. Diese Geisteshaltung fällt bei dem jungen Mann auf fruchtbaren Boden: Zugang zu Bildung gehöre zur Würde des Menschen, Bildung sei ein Gradmesser für das Niveau einer Gesellschaft. Er stürzt sich auf jede Wissenschaft, lernt, begreift, ein Hochbegabter eben. 17 ist er erst, als er dann in Tübingen als Bester sein Examen abschließt. Doch nicht nur als Selbstzweck.
Er wird ein leidenschaftlicher Lehrer werden mit Blick für die Methodik des Lernen und Lehrens. Er bringt die Gründung dreiklassiger Lateinschulen voran, schreibt Lehrbücher für Studenten, erstellt Lehrpläne für die Kleinen, denn „einen Zweitklässler dürfe man nicht mit schweren, hohen Büchern wie etwa dem Römerbrief beladen“. Ja, und zum Segen oder Leidwesen manchen Schülerdaseins gründet er Oberschulen mit breit gefächertem Lehrplan: nicht nur Sprachen sondern auch Mathematik, Geschichte, Geografie. Sie wurden zum Vorbild des modernen humanistischen Gymnasiums. Für seine Verdienste um das Bildungswesen erhielt Melanchthon schon Ende des 16. Jh. den Ehrentitel „Lehrer Deutschlands“.
Johannes Reuchlin hat Philipp Schwartzerdt auch seinen neuen Namen zu verdanken. Humanisten legten sich gerne griechische oder lateinische Gelehrtennamen zu. „Schwarze Erde“ heißt auf Griechisch: Melanchthon. Im Gebrauch stellt sich der Name aber als kompliziert heraus, so dass Melanchthon sich kurzerhand nur noch Melanthon nannte. Das kann ich gut verstehen.
Wie oft ich schon Melanchthonstraße buchstabieren musste!
An einer anderen Ecke des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, an der Universität zu Wittenberg, wird 1518 ein Griechischlehrer gesucht. Der Kurfürst fragt bei Johannes Reuchlin an, doch der winkt ab und verweist auf seinen entfernten Großneffen Melanchthon, der als dann ein Jahr nach Luthers Thesenanschlag das Zentrum der reformatorischen Bewegung an der Elbe betritt.
Auf den ersten Blick reibt man sich dort die Augen: Der! Melanchthon ist nur 1,50 groß, schmächtig, hat eine dünne Stimme und einen leichten Sprachfehler. Doch nach der Antrittsvorlesung, in der er auf Latein ein humanistisches Bildungsprogramm entwirft, sind alle, auch Luther, restlos begeistert. Die beiden befruchten sich gegenseitig: Luther besucht Melanchthons Griechischunterricht, Melanchthon dessen Theologieverlesung. Bei Luther habe ich das Evangelium gelernt“, sagt der eine. „Dieser kleine Grieche übertrifft mich auch in der Theologie.“ der andere.
An dieser Stelle müssen wir unser Lutherbild zurecht rücken. Die Übersetzungsarbeit in der Wartburg fand nämlich unter tätiger Mithilfe von Melanchthon statt. Weil er Griechisch und Hebräisch einfach besser konnte. Die Lutherbibel ist eigentlich eine Luther-Melanchthon-Bibel.
Es ist bei den beiden keine einfache Männerfreundschaft. Luther, 13 Jahre älter, ließ fast nur seine Meinung gelten. Darunter hat Melanchthon oft gelitten. Aber um der Sache willen, der Reformation, hat er stets loyal an seiner Seite gestanden.
Luther wiederum wusste schon, was er an ihm hatte. In einem Brief an Melanchthon lobt er einmal dessen Dialogfähigkeit bei theologischen Auseinandersetzungen :
Er, Luther, könne nicht so leise treten. Will meinen: Ich kann nur mit dem Kopf durch die Wand.
Ein bisschen „Goldenes Blatt“ an dieser Stelle: Melanchthon lebte die ersten beiden Jahre in Wittenberg in einer Art „Studenten-WG“. Luther, da noch lediger Mönch, bereitete dies Sorge, denn möglicherweise würde Melanchthon nicht genug essen und so seine Gesundheit ruinieren. Er drängte ihn zu heiraten. Melanchthon fügte sich widerwillig und heiratete die Bürgertochter Katharina Krapp. Doch womit Luther nicht gerechnet hatte: Katharina war nicht fähig, einen Haushalt zu führen. Zum Glück besaß Melanchthon einen langjährigen Freund und Diener, der sich um Haushalt und Kindererziehung dann viele, viele Jahre kümmerte.
Jetzt wissen wir ein wenig über Melanchthon und haben immer noch nicht über sein Wirken während der Reformation gesprochen. Melanchthon hat die gesamte Reformationsgeschichte miterlebt und mitgestaltet. Er rang und stritt mit allen Größen seiner Zeit: dem Katholiken Eck, mit Zwingli, Calvin. Über dreißig Jahre ist er auf Achse im Reich, nimmt als die evangelische, theologische Instanz immer und immer wieder an Religionsgesprächen teil: Wie feiert man das Abendmahl recht?
Was bedeutet Gnade? Sollen Kinder getauft werden? Dabei ringt er nicht nur mit den Katholiken um die rechte Art des Glaubens, sondern versucht auch die auseinanderdriftenden evangelischen Strömungen zusammen zu halten.
Zum Ende hin ist er zermürbt und es herzlich leid. In seiner allerletzten Aufzeichnung führt er Gründe an, warum man den Tod nicht fürchten müsse. In einem heißt es: Du wirst befreit von aller Mühsal und der Wut der Theologen.
Eine Sache aus Melanchthons theologischem Erbe habe ich mir herausgepickt. Schon rund 10 Jahre nach Luthers Thesenanschlag bekennen sich neunzehn Länder und Städte zur neuen Lehre und wollen sich nicht mehr von der katholischen Kirche bevormunden lassen. Sie fordern: Jeder Reichsstand müsse selbst in Verantwortung vor Gott entscheiden können, ob er der Reformation folgen oder beim alten Bekenntnis bliebe solle. Die Katholiken sehen die Einheit der Kirche in Gefahr, Karl der V. die Einheit des Reiches.
Um diesen Streit zu schlichten, beruft er 1530 den Reichstag zu Augsburg ein. Und fordert die evangelische Seite auf, in der Reichsversammlung ihren Glauben darzulegen. Luther kann wegen seiner Ächtung durch den Papst Sachsen nicht verlassen. Und so finden an der Grenze in Coburg die letzten Besprechungen statt, danach ist nur noch Briefverkehr möglich.
Die Hauptverantwortung liegt nun bei Melanchthon. Von Mai bis September weilt er in Augsburg und feilt an einem Bekenntnis. Es muss sowohl die Katholiken überzeugen, als auch den verschiedenen Strömungen in den eigenen Reihen genehm sein. Es gilt Formulierungen zu finden, in denen sich jeder wiederfinden kann.
Beim Verlesen in der Reichsversammlung ist er nicht dabei, er bleibt in seiner Augsburger Herberge und weint vor Erschöpfung. All sein Herzblut hat er hineingelegt. In die „Confessio Augustana“, das Augsburger Bekenntnis.
Schon bald wird es als offizielles lutherisches Bekenntnis angesehen. Und so steht es auch in unserem Gesangbuch. Mit allem, was es zum Evangelisch sein braucht.
Ganz besonders natürlich die Ausführungen zur Rechtfertigung in Artikel 4: …Weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unser Verdienst, Werk und Genugtuung erlangen können, sondern dass wir Vergebung der Sünde bekommen und vor Gott gerecht werden aus Gnade um Christi willen durch den Glauben
Sola Fide – Sola Gratia: Luthers Kurzformel: Allein der Glaube, allein die Gnade Ausformuliert, theologisch präzise und doch verständlich. Das konnte Melanchthon wie kein zweiter.
Mir ist ein Satz in Artikel 7 aufgefallen: „Von der Kirche“ Da heißt es u.a.: Und es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen Kirche nötig, dass überall die gleichen, von den Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden, wie Paulus sagt: „Ein Leib und ein Geist, berufen zu einer Hoffnung“. Da staunt der Laie: Hab ich doch schon immer gesagt. Welch eine Einsicht!
Für die Einheit der Kirche kann Melanchthon es aushalten, wenn Gott auf unterschiedliche Art und Weise die Ehre gegeben wird. Mit dem Augsburger Bekenntnis wollte er den Laden zusammenhalten. Ziel all seines Wirkens in den dreißig Jahren war immer die Ökumene in ihrem Wortsinn.
Melanchthon wollte eine Kirche für alle Menschen. Einen Arbeitskreis christlicher Kirchen löblich, eine ökumenische Bewegung, immerhin Bewegung. Zwei Kirchen nebeneinander in versöhnter Verschiedenheit – mal mehr versöhnt, mal mehr verschieden – damit hätte ein Melanchthon sich nicht zufrieden gegeben.
Melanchthon wollte zusammenführen und zusammenhalten.
Kein Geringerer als der Theologieprofessor Joseph Ratzinger, Papst Benedikt XVI., hielt Anfang der 60ger Jahre Melanchthonseminare. Er hoffte, durch dessen Werk die Ökumene voranbringen zu können.
In Augsburg wird die „Confessio Augustana“ abgelehnt. Was folgt sind theologische Auseinandersetzungen zuhauf, der Schmalkaldische Krieg, bis endlich 25 Jahre später wiederum in Augsburg der Religionsfriede geschlossen wird.
In diesen Jahren holten Melanchthon immer wieder seine Kindheitserlebnisse ein. Was muss das mit dem Mann gemacht haben, der doch vor allem eines wollte: Einen. Halt findet er im täglichen Gebet: immer und immer wieder für den Frieden.
Das Bild Cranachs zeigt ihn als einzigen Reformator mit gefalteten Händen. Für Melanchthon war das Gebet stete Übung und Kraftquell zugleich. Vielleicht ist das etwas, was wir von Melanchthon für den Hausgebrauch mitnehmen können: Das Beten. In Zeiten, die uns so verwirren, die belasten, die Sicherheiten in Frage stellen, die uns erschüttern, durch Krieg und Gewalt…
Melanchthon sagte: Sorge und Niedergeschlagenheit treiben mich ins Gebet, und das Gebet vertreibt Sorge und Niedergeschlagenheit.
In dem Buch „Der Bademeister ohne Himmel“ antwortet eine Krankenpflegerin auf die Frage „Warum sie bete: Beten macht Stress klein. Beten macht Stress klein. Das kann man sich vielleicht besser merken.
Am 19.4.1560 verstirbt Philipp Schwarzerdt mit 63 Jahren, sein Lieblingswort aus dem Römerbrief vor Augen: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein.
Und davon singen wir jetzt.
gehalten von Prädikantin Monika Ruhnau am 27.07.2025

Bilder: www.gemeindebrief de