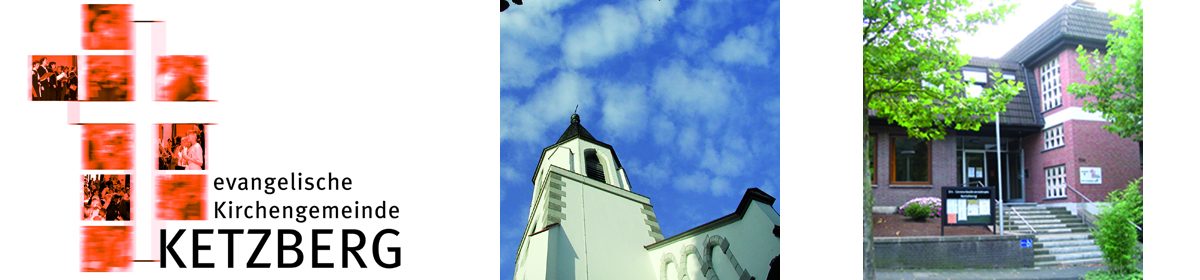Johann Hinrich Wichern – Theologe und Sozialpolitiker, Visionär und Pragmatiker, ein liebevoller Erzieher, nebenbei der Erfinder des Adventskranzes, vor allem aber ein engagierter Christ und nun auch Glaubensvorbild. Die Kirche verdankt ihm im 19. Jahrhundert die Wiederentdeckung ihres diakonischen Auftrags.
Er weckt die evangelische Kirche Deutschlands mit seinem sozialen Engagement aus dem Schlaf der Selbstgerechtigkeit. Und seine Botschaft ist klar und eindeutig: Taten der Liebe sind wichtiger als schöne Worte. Heute ist die evangelische Kirche ohne Herausforderungen von Nächstenliebe und Diakonie nicht mehr denkbar.
Wer war dieser Mann? Geboren 21.04.1808 – gestorben 07.04.1881 beides in Hamburg, aus einfachen Verhältnissen, 1835 Heirat mit Amanda Böhme (1810-1888) – 9 Kinder, eins verstarb früh – Gezeichnet von mehreren Schlaganfällen stirbt Wichern nach jahrelangem Leiden im Alter von 72 Jahren 1881 im Rauhen Haus in Hamburg.
Das sagt Wikipedia: Johann Hinrich Wichern war ein deutscher Theologe, Sozialpädagoge und Gefängnisreformer. Er gründete das Rauhe Haus in Hamburg und gilt als Begründer der Inneren Mission der evangelischen Kirche, als einer der Väter der deutschen Rettungshausbewegung sowie als Erfinder des Adventskranzes.
Die fett markierten Überschriften möchte ich herausgreifen, um drei Impulse aus dem reichen und vielfältigen Leben und Wirken Wicherns für uns heute fruchtbar zu machen. Ich kann und will hier kein umfassendes Lebensbild Wicherns präsentieren, sonst sind wir morgen noch nicht fertig.
Er gründete das Rauhe Haus in Hamburg
Wichern schreibt als junger Theologe Tagebuch. Und was er an einem Abend aufschreibt, macht ihm Angst und macht ihn sprachlos. In einer heruntergekommenen Wohnung in Hamburg St. Georg hat er eine verwahrloste Familie angetroffen. Alles zerlumpte, blasse Gestalten, klappernd vor Hunger und Frost. „Ich habe in traurige, ausdruckslose Augen gesehen, ohne Hoffnung auf morgen. Feuer haben sie nicht mehr gehabt seit langer Zeit. Zu essen haben sie ein Stück Brotrinde, das sie sich teilen. Was für ein Elend.“ So seine Tagebuchaufzeichnungen.
1832 ist er nach seinem Theologiestudium als frisch berufener Oberlehrer in der Sonntagsschule der evangelischen Gemeinde St. Georg eingesetzt. Mehr als 400 Kinder und Jugendliche sind hier zu betreuen. St. Georg – ein Quartier mit einer jahrzehntelangen Elendsgeschichte. Hierher hatte man schon im Mittelalter Lepra- und Pestkranke gebracht, hier stand auch der Hamburger Galgen, hier ist die Wohnungsnot besonders groß. Es ist eine lebensfeindliche, unfreundliche Gegend. Huren und Trinker machen sich dort die Nacht zum Tag. Haarsträubende Verhältnisse kommen Wichern zu Gesicht – Armut, Gewalt, Verwahrlosung. Und am meisten leiden die Kinder; es gibt keine Zukunft für sie.
Die Städtische Fürsorge ist schon seit langem vollkommen überfordert. Es scheint keinen zu interessieren. Wichern lässt das jedoch alles nicht kalt. Er sieht sich in seinem Glauben herausgefordert. Kein anderer als er selbst muss handeln, frei nach seinem Motto: „Was man will, muss man ganz wollen, halb ist es gleich nichts.“
Wichern sucht Unterstützer und findet sie. Er kann gegen eine günstige Miete eine als „Rauhes Haus“ bekannte Bauernkate erwerben und gründet im Hamburger Vorort Horn seine Anstalt „zur Rettung verwahrloster und schwer erziehbarer Kinder“, die zum Jahresende 1833 mit zwölf Jungen ihre Arbeit startet. Danach wächst die Zahl der Gruppen und mit ihr der Häuser rasch an. Wicherns Ideologie ist keine der damals üblichen Straferziehung, sondern eine religiöse Erziehung in der Gemeinschaft und ein Leben mit dem Evangelium, das von Liebe und Barmherzigkeit, Vergebung und Nächstenliebe spricht. Seine Frau Amanda kümmert sich übrigens immer mit und hat später besonders auch die Mädchen im Blick.
Jedem neuen Kind sagte Wichern zu Beginn bei der Aufnahme: „Mein Kind, dir ist alles vergeben. Sieh um dich her, in was für ein Haus du aufgenommen bist. Hier ist keine Mauer, kein Graben, kein Riegel, nur mit einer schweren Kette binden wir dich hier, du magst wollen oder nicht, du magst sie zerreißen, wenn du kannst, diese heißt Liebe und ihr Maß ist Geduld. Das bieten wir dir, und was wir fordern, ist zugleich das, wozu wir dir verhelfen wollen, nämlich, dass du deinen Sinn änderst und fortan dankbare Liebe übest gegen Gott und den Menschen!“
Die tägliche Praxis – das ist es, was für Wichern zählt. Er ließ sich von der Not der Menschen anrühren. Die Stiftung Rauhes Haus ist heute mit verschiedenen Einrichtungen, Wohngruppen und Stadtteilbüros in Hamburg und Schleswig-Holstein vertreten und betreut Kinder, Jugendliche und ihre Familien, alte Menschen, geistig Behinderte und psychisch Kranke. Sie unterhält außerdem die evangelische Wichern-Schule, die Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie und die Evangelische Berufsschule für Pflege.
Begründer der Inneren Mission der evangelischen Kirche
Die Liebe gehört mir wie der Glaube – mit dieser Haltung wirkt Wichern nicht nur intern in seinen familienähnlichen Rettungshäusern, sondern auch in seine Kirche hinein. In Wichern wächst nach vielen Jahren sozialer Arbeit der Wunsch, nicht nur einzelne Menschen, sondern auch Strukturen zu verändern.
Beim Kirchentag in Wittenberg im September 1848 hält Wichern spontan eine 75-minütige leidenschaftliche Rede, die als programmatisch für die moderne Diakonie gilt. Mit seinem zentralen Satz „Die Liebe gehört mir wie der Glaube!“ ruft er die evangelische Kirche auf, sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst zu werden. Sozialarbeit gehört zur ureigenen Aufgabe der ganzen Kirche. Und er hat Erfolg. Ein deutschlandweiter „Centralausschuss für Diakonie“ wird gegründet, die Geburtsstunde der „Inneren Mission“.
Er möchte ins innere der Gemeinden wirken. Die vielen Menschen erreichen, die zwar getauft sind, und so zur Kirche gehören, aber ihre Bindung an sie verloren haben, warum auch immer. Für Wichern gehörten Glaube an Gott und Nächstenliebe, Mission und Diakonie, Erneuerung der Kirche und Erneuerung der gesellschaftlichen Verhältnisse, zusammen. Das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus, der Ruf zum Glauben waren für ihn Quelle der Kraft und der Rettung der Menschen.
Seine ersten Ziele: Kampf gegen Revolution und Armut, Betreuung der Strafgefangenen, Schutz von jungen Frauen vor der Prostitution. Jetzt ist Wichern die zentrale Figur in der Organisation und Verknüpfung diakonischer Arbeit in Deutschland. Wicherns Reformideen reichen weit über die kirchlichen Institutionen hinaus. Er wird einer der Berater für das 1849 gegründete preußische Mustergefängnis Moabit, später dessen Direktor. Er wird vom König in die Berliner Kirchenleitung berufen, gründet 1858 die diakonische Ausbildungsstätte Brüderwerk Johannesstift.
Wichern hat nicht zugesehen oder weggesehen, er hat angepackt, zugepackt. Er stand für seinen christlichen Glauben auf der Grundlage des Evangeliums und dem von Jesus Christus überlieferten sog. „Doppelgebot“ der Liebe: „Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst.“
Und das war für ihn nicht nur theologische Fachsimpelei, sondern gelebter, tätiger Glaube. Nächstenliebe und Solidarität, ja, das strahlte Johann Hinrich Wichern aus, dafür steht das Rauhe Haus noch heute: „Wir achten jeden Menschen, ungeachtet seiner Herkunft, Religion oder sozialen Stellung, als ein einmaliges und unverwechselbares Geschöpf Gottes. Wir haben Respekt vor seiner Würde und stärken seine Autonomie. Ursprung und Merkmal aller unserer Aktivitäten ist die christliche Nächstenliebe, solidarisches Engagement und die Entwicklung innovativer Angebote.“
Die Kirche muss zu den Menschen gehen!
Als Gemeinden und als Kirchenkreis ist uns heute hier in Solingen die diakonische Arbeit wichtig. Wie dankbar sind die Menschen, die ich in der Essensausgabe in Ohligs erlebe, für die warme Mahlzeit, die wir ihnen ermöglichen. Für ein gutes Wort und ein Willkommen.
Da ist die Frau, die mit Sach und Pack kommt, einfach nur müde und erschöpft wirkt. Danke, sagt sie, nachdem sie auch bei der Osterandacht mit Osterfrühstück auftaucht. Ich sollte viel öfter herkommen. Da ist der junge Mann, sichtbar betrunken, viele schlecht verheilte Wunden. Er setzt an zu erzählen, findet keine Worte. Sagt dann: Einfach nur Danke hierfür.
Die Kirche muss zu den Menschen gehen. Das hat nie an Aktualität verloren. Jesus hat es vorgemacht, er war nahe bei den Menschen. Paulus ist in alle Welt gereist, um die Liebe Gottes groß zu machen.
Heute erleben wir, dass Menschen nicht mehr hierher kommen, in unsere Gebäude und Versammlungsorte der Gemeinde. Wie viel mehr machen wir uns Gedanken darüber, wie wir zu ihnen gehen können. Und ihnen so den Zugang erleichtern und die Liebe Gottes weitersagen und geben können. Und wir erleben, dass sich 33 Menschen unter der Müngstener Brücke taufen lassen, sich jetzt schon 18 Paare für unser Hochzeitsfest im September angemeldet haben. Wir gehen neue Wege, um die Menschen zu erreichen.
Erfinder des Adventskranzes
Ja, zum Schluss, Punkt 3, was viele wissen, dass Wichern als Erfinder hinter dem Adventskranz steht. Der gehört für uns heute in jeden adventlich geschmückten Haushalt. Kirche und Gemeindehaus ziert ein Adventskranz, in Solingen hat der Adventskranz sogar gewonnen gegenüber dem Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz.
Wichern stellte 1839 im damaligen Betsaal auf dem Stiftungsgelände in Hamburg-Horn den ersten Adventskranz der Welt auf, ein Wagenrad mit vielen Lichtern. Anders als der heute verbreitete Kranz mit vier Kerzen, trug er für jeden Tag bis zum Heiligen Abend eine große weiße für die Sonntage und kleine rote für die Werktage. Wichern wollte die vielen Kinder im Rauhen Haus damit erfreuen und die Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest sinnlich erfahrbar machen. Noch heute wird im Hamburger Rauhen Haus der traditionelle Wichern-Kranz mit – je nach Jahr – bis zu 28 Kerzen entzündet.
Wichern nahm ein Wagenrad und befestigte darauf so viele Kerzen, wie es Tage vom ersten Advent bis zum Heiligen Abend waren – anders als bei den heutigen Adventskalendern, die die Tage vom ersten Dezember bis Weihnachten zählen und dabei natürlich immer 24 Tage anzeigen. Vom ersten Advent bis Weihnachten sind es jedes Jahr unterschiedlich viele Tage – nämlich 22, wenn Heiligabend auf den vierten Adventssonntag fällt, bis höchstens 28, wenn Heiligabend am Sonnabend nach dem vierten Advent ist. 1839 waren es 24.
Einen netten Nebeneffekt hatte der Kranz auch: Die Kinder lernten auf einfache Weise das Zählen. Erst um 1860 wurde der Kranz auch mit Tannengrün geschmückt und setzte sich in evangelischen Kirchen und Privathaushalten bis Anfang des 20. Jahrhunderts allgemein durch.
1925 soll auch erstmals ein Kranz in einer katholischen Kirche in Köln gehangen haben. Spätestens ab der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg findet man ihn in aller Welt und in allen möglichen Formen. Heute gibt es Kränze aus Frottee, aus Plastik, aus Porzellan, ausklappbare Kränze für die Reise und vieles mehr. Eines haben sie alle gemeinsam: Im Gegensatz zum Wichern-Kranz stecken darauf nur noch vier Kerzen – für die Adventssonntage. Die restlichen Kerzen sind im Laufe der Zeit auf der Strecke geblieben.
Ganz zum Schluss – der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, bezeichnete Johann Hinrich Wichern als „die größte Gestalt im deutschen Protestantismus des 19. Jahrhunderts“. Und „er hatte keine Zeit, ein großer Theologe zu werden, weil es ihn eilte, ein guter Christ zu sein“.
„Die Liebe gehört mir wie der Glaube!“ dieses Zitat von ihm aus seiner leidenschaftlichen Rede 1848 in Wittenberg (die übrigens nicht schriftlich vorliegt, da sie so spontan kam und keiner so schnell mitgeschrieben hat) zeigt, was sein Antrieb war und fasst sein Vermächtnis für heute zusammen.
Mir ist Johann Hinrich Wichern schon immer ein wichtiges Vorbild im gelebten und tätigen Glauben gewesen und durch die Vorbereitung für heute einmal mehr.
gehalten am 13.07.2024 von Diakonin Bärbel Albers

Bilder: www.gemeindebrief.de