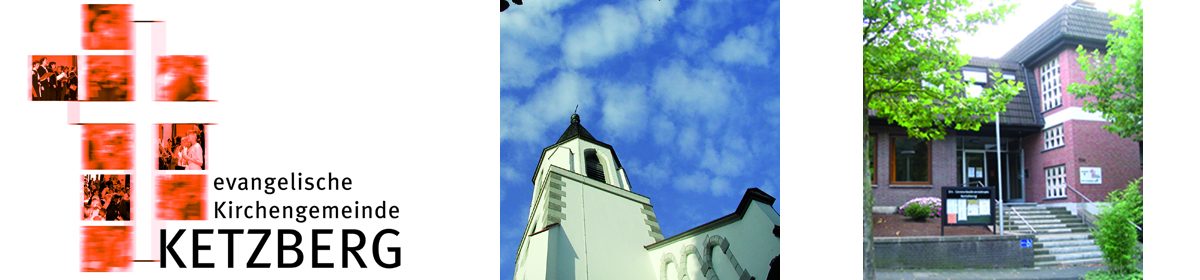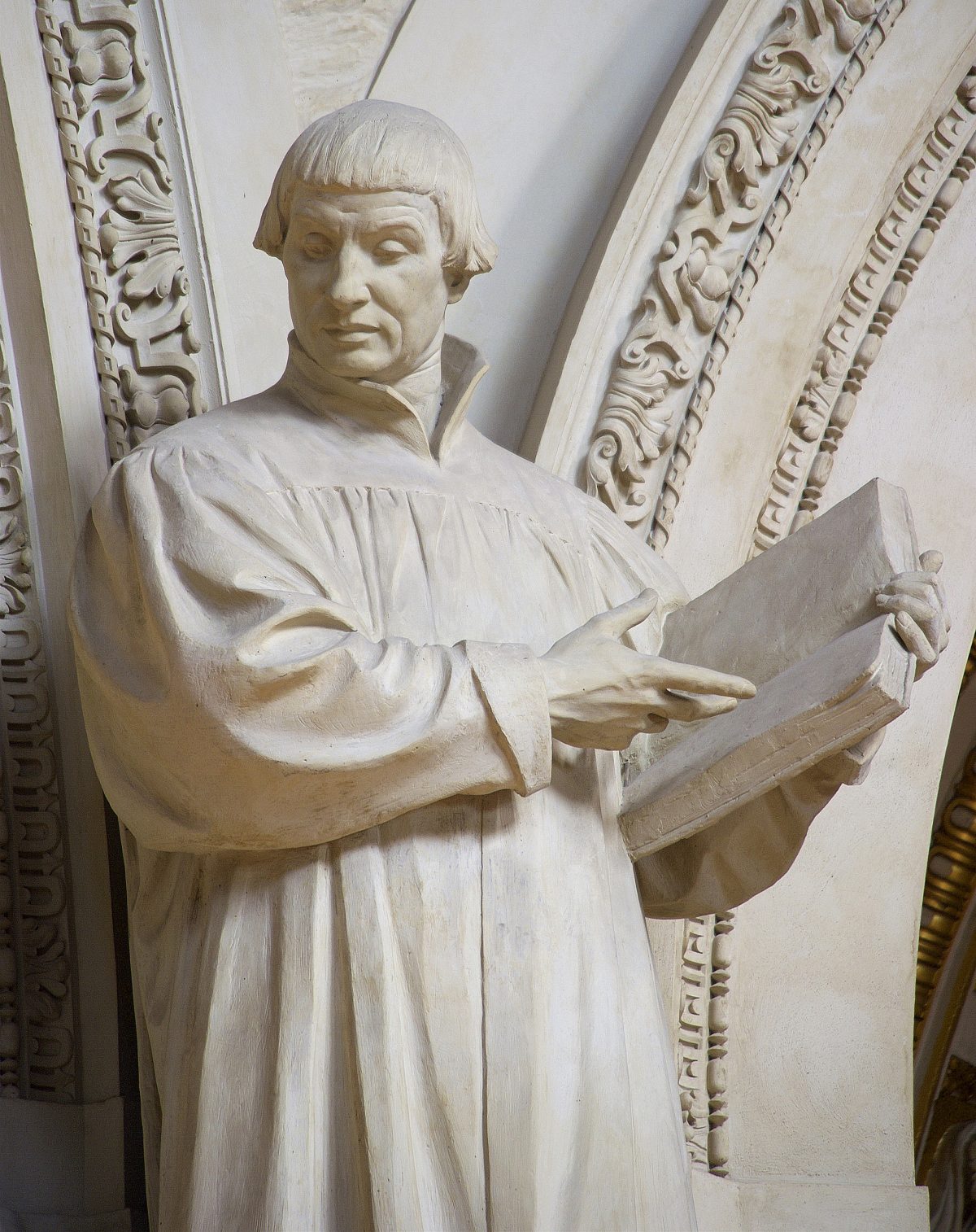Gnade sei mit uns und Friede, von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen
Liebe Gemeinde! Die Kirchen in der Schweiz feierten erst 2019 ihr 500-jähriges Reformationsjubiläum. Denn in jenem Jahr wurde ihr Reformator Ulrich Zwingli, der am 1. Januar 1484 in Wildhaus in der Grafschaft Toggenburg in der Fürstabtei St. Gallen geboren wurde und damit nur wenige Wochen jünger als Martin Luther war, zum Pfarrer des einflussreichen Großmünsterstiftes nach Zürich berufen, wo er bis zu seinem Tod gewirkt hatte. Er wurde am 11. 10. 1531 als Feldprediger in der Schlacht bei Kappel am Albis, südwestlich von Zürich, gegen die katholischen Kantone von einem Gegner erschlagen, als er gerade seelsorgerlich mit einem Sterbenden betete.
Der Trailer zu einem Zwingli-Film charakterisiert eindrucksvoll die Umstände vor 500 Jahren: „Es war eine düstere Zeit, geprägt von religiösem Fanatismus und Gewalt.“ Zwingli und andere Reformer fühlten sich gerade von dem Satz Jesu aus Johannes 8, Vers 31 + 32 angesprochen: „Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen.“
Was war für den Züricher Reformator die Wahrheit? Die Wahrheit ergab sich allein aus Gottes Wort, das er, wie übrigens auch Luther, jetzt in deutscher Sprache seiner Züricher Gemeinde verkündigen wollte. Zugleich war er der Auffassung, dass sich von nun an niemand mehr zwischen Gott und uns Menschen stellen dürfe. Diese Auffassung hielt die hierarchisch geprägte katholische Kirche für ketzerisch, denn sie war doch in jener Zeit die alleinige Institution, die das Heil der Gläubigen verwaltete und die durch ihren Papst und durch ihre Priester, aber auch durch die vielen Heiligen die wichtige Funktion eines Brückenbauers zwischen Mensch und Gott innehatte. Nicht umsonst führt der Papst auch heute noch den aus der heidnisch-römischen Religion stammenden Titel „pontifex maximus“, oberster Brückenbauer.
Wie alle reformatorischen Bewegungen wollte auch die Erneuerung Zwinglis das Evangelium, die Heilige Schrift, die im katholischen Mittelalter nur eine untergeordnete Rolle spielte, zu neuem Leben erwecken und die Bibel gewissermaßen zur Magna Charta des Glaubens machen, so wie es der englische Theologe John Wiclif schon im 14. Jahrhundert formuliert hatte.
Zwingli propagierte auch die Freiheit eines jeden Menschen, und hieraus wird sichtbar, dass die Reformation eine Emanzipationsbewegung war, die jedem Menschen die religiöse Befreiung von der mittelalterlichen Kirche ermöglichen wollte und somit für einen freien und unmittelbaren Zugang des Gläubigen zu Gott eintrat.
Wie ist es zu diesen für die damalige Zeit revolutionären Ideen gekommen? Es war die Zeit des Humanismus , der sich auf die klassische Antike mit ihrer Humanitas und ihrem Ideal eines freien und selbstbestimmten Menschen bezog, wie man sie zum Beispiel bei Cicero vorfinden konnte. Die Gebildeten hatte die ständige Bevormundung durch die katholische Kirche satt, vor allem ihre unbarmherzige und lebensbedrohende Inquisition in Bezug auf alle abweichenden Glaubenslehren. Deshalb kehrten die Humanisten zu den Quellen „ad fontes“ zurück, zu den Originaltexten, und dazu gehörte auch die Bibel, die man jetzt selber in den Ursprachen Hebräisch und Griechisch lesen wollte. Die katholische Kirche sollte von nun an nicht mehr allein die unfehlbare Auslegerin der Heiligen Schrift sein, zumal sich ihre Päpste und Priester zum allergrößten Teil selber nicht an die biblischen Vorgaben hielten und zudem meist theologisch sehr schlecht ausgebildet waren.
Ulrich Zwingli hatte seit 1502 in Basel studiert und zu Beginn des Jahres 1506 seine Ausbildung mit dem Titel „Magister Artium“ abgeschlossen. Er hatte damit eine gängige spätmittelalterliche Gelehrtenausbildung erhalten, die in erster Linie darauf ausgerichtet war, die lateinische Sprache und die üblichen philosophischen Fundamentalbegriffe zu vermitteln. Wie viele seiner Zeitgenossen wechselte Zwingli bald nach dem Magisterexamen ohne gründliches Theologiestudium in die kirchliche Praxis und wurde dann im September 1506 in Konstanz zum Priester geweiht.
Schon in seiner ersten Pfarrstelle in Glarus, die er für 10 Jahre innehatte, und auch als Priester in dem bekannten Wallfahrtsort Maria Einsiedeln, wo er von 1516–1518 vor allem die Einwohner des Tales und auch die Pilger seelsorgerlich betreuen sollte, hatte sich Zwingli intensiv mit den Schriften des sehr berühmten Humanistenfürsten Erasmus von Rotterdam auseinander gesetzt, der von 1466 bis 1536 lebte, und auch das Griechische erlernt. Erasmus hatte 1516 eine kritische Edition des griechischen Neuen Testaments veröffentlicht und war mit dieser Leistung zum führenden Humanisten seiner Zeit geworden.
Im gleichen Jahr 1516 war Zwingli dem Erasmus, der in Basel wirkte, persönlich begegnet, und dieser Humanist hatte einen überwältigenden Eindruck auf ihn gemacht, sodass er ihn mit der zutreffenden Aussage würdigte, dass keiner sich um die Heilige Schrift so verdient gemacht habe wie er. Erasmus hatte Zwingli einen neuen, befreienden Zugang zur Schrift gelehrt und ihn auf das Zentrum der Bibel, auf die Verkündigung Christi, hingewiesen. Das Reformchristentum des Erasmus, der trotz seiner starken Kritik an der dekadenten Kirche katholisch blieb, propagierte besonders die christliche Predigt und verwahrte sich gegen ein Frömmigkeitswesen, das von kirchlichen Gesetzen und Geboten überfrachtet war und nur aus der ständigen Angst heraus praktiziert wurde, um nicht nach dem Tode wegen fehlender guter Werke unerlöst im Fegefeuer gepeinigt zu werden. Zwingli dachte zunächst ganz im Sinne des Erasmus nicht daran, das herrschende Kirchentum gewaltsam umzustürzen, sondern er wollte seine Gemeinde durch sein humanistisches Christentum sittlich verbessern und nach und nach eine geläuterte Frömmigkeit herstellen. Genauso wie Luther sah Zwingli in der Bibel die höchste Autorität. Sie ist die von Gott selbst inspirierte, irrtumslose Urkunde und als solche das Gottesgesetz, das alles Leben normieren will.
Dieser Gedanke, dass allein die Bibel die Magna Charta des Glaubens sei und über den Äußerungen des Papstes stehe, wurde schon, wie erwähnt, von dem englischen Vorreformator John Wiclif im 14. Jahrhundert vertreten, und dieses Bibel-zentrierte Denken bezahlte der böhmische Vorreformator Jan Hus auf dem Konzil zu Konstanz 1415 sogar mit seinem Leben, als er wegen seiner konsequenten biblischen Lehren als Ketzer verbrannt wurde.
Mit seinen reformkatholischen Ansichten im Sinne des Erasmus stellte Zwingli in Zürich die Predigt in den Mittelpunkt des Gottesdienstes und kritisierte die übermäßige Heiligenverehrung und prangerte das hoffärtige und wollüstige Leben der Mönche an.
Zwingli wurde auf Luther aufmerksam, als dieser auf der Leipziger Disputation im Sommer 1519 öffentlich die Irrtumslosigkeit der Konzilien bestritt und die heilsnotwendige Autorität des Papsttums leugnete. Allein die Schrift (sola scriptura) sei maßgebend, und der Papst könne und dürfe nicht der unfehlbare Ausleger dieser Schrift sein. Damit lehnte Luther kategorisch den Primat des Papstes und dessen normative Schriftauslegung ab.
Am 9. März 1522 versammelten sich am 1. Fastensonntag ungefähr ein Dutzend Leute im Hause des Züricher Buchdruckers Christoph Froschauer, und diese aßen zwei geräucherte Würste. Wenngleich Zwingli als einziger der Anwesenden nicht mitaß, um als Seelsorger eine gewisse Neutralität zu bewahren, so verfasste er im Frühjahr 1522 seine erste reformatorische Schrift: „Von Erkiesen und Freiheit der Speisen“ und machte mit Bezug auf das Neue Testament der erregten Züricher Bürgerschaft deutlich, dass es dem einzelnen freigestellt sei, in der Vorosterzeit zu fasten oder nicht. Eine Zeitschrift verglich vor kurzem die beiden reformatorischen Anlässe bei Luther und Zwingli mit der süffisanten Überschrift: „Statt Hammerschläge ein Mettwurstessen.“
Diese Fastenprovokation zog eine Untersuchung durch den Bischof von Konstanz nach sich, zu dessen Diözese auch Zürich gehörte, doch der Rat stellte sich hinter Zwingli und damit bröckelte die bischöfliche Autorität. In seiner supplicatio, einer Bittschrift an den Konstanzer Bischof Hugo, verlangte Zwingli im Sommer 1522 die Aufhebung des Zölibats und die freie Predigt des Evangeliums. Diese Eingabe erschien 2 Wochen später anonym in deutscher Sprache und appellierte auch an die politischen Instanzen, die Priesterehe zu erlauben und den Priesterfrauen und Kindern den üblichen rechtlichen Schutz zu gewähren. Die Frage der Priesterehe war mittlerweile für Zwingli selbst kein theoretisches Problem mehr, da er seit Anfang 1522 mit der gleichaltrigen Witwe Anna Reinhart in heimlicher Ehe lebte, die 1538 starb. Die öffentliche Trauung fand erst am 2. April 1524 statt und aus dieser Ehe stammten 4 Kinder.
Der Konstanzer Bischof Hugo forderte die Züricher Obrigkeit zur Einhaltung der kirchlichen Ordnung und zum Schutz der Kirche auf und bezichtigte den Reformator des Aufruhrs, der Kirchenspaltung und der Ketzerei.
Zwingli bestritt in seiner Antwort der kirchlichen Hierarchie wegen ihres verdorbenen Zustandes das Recht, in Bezug auf die Verkündigung des Evangeliums oder die kirchliche Ordnung überhaupt zu urteilen. Er meinte, das Volk könne keineswegs verführt werden, wenn es ihm darum gehe, die evangelische Lehre vorzulegen. Diese Predigt könne weder kirchenspaltend noch ketzerisch sein, da sie Christus verkündige, der das alleinige Fundament der Kirche sei. Zwingli meinte, der Bischof stehe auf der Seite der Menschenworte, die Reformgesinnten ständen auf der Seite Christi. Auf diesen schonungslosen Angriff reagierte Erasmus mit Entsetzen, und die klare und strikte Absage an die kirchliche Hierarchie wurde dann zum generellen Unterscheidungsmerkmal zwischen dem gemäßigten humanistischen Reformstreben und der eher revolutionären reformatorischen Erneuerung.
Zwingli drängte den unschlüssigen Rat zur 1. Züricher Disputation am 29. 1. 1523, wozu auch der Bischof aus Konstanz eingeladen war. Diese Disputation, für die Zwingli seine 67 Schlussreden verfasste, die als seine bedeutendste reformatorische Schrift gilt, blieb zwar ohne eigentliches Ergebnis, da der Führer der Gegner, der Konstanzer Generalvikar Johann Faber (26), der Versammlung das Recht bestritt, über die diskutierten Fragen zu entscheiden. Daher hörten die Leute des Bischofs nur zu und sollten sich nicht an der Diskussion beteiligen, sondern nur gegen diese in ihren Augen unrechtmäßige Versammlung protestieren. Aber der Rat entschied letztendlich, dass fortan alle Prediger das Evangelium zu verkündigen hätten. Somit kann man bei dieser Disputation auch von der Gründungsversammlung der evangelischen Kirche von Zürich sprechen.
In diesen Schlussreden, die Kernsätze aus Zwinglis Predigten beinhalten, machte der Reformator deutlich, dass das Evangelium die Grundlage des Glauben sei, und die Summe des Evangeliums sah er in Jesus Christus, der die Gläubigen mit seinem unschuldigen Leiden vom Tod erlöst hat. So vertrat Zwingli genau wie Luther das Prinzip des solus Christus und der sola scriptura, dass also allein Jesus Christus und allein die Bibel für den Glauben normativ seien. Mit dieser Definition lehnte Zwingli klar das kirchliche Lehramt und die unbiblischen kirchlichen Gebräuche ab und meinte: „Gott will, dass man allein auf Christus, das Haupt, hört, denn im Glauben an ihn besteht unser Heil. So lernt man, dass Lehren und Satzungen der Menschen zur Seligkeit nichts nützen.“
Auch in Zürich gab es im Herbst 1523 einen Bildersturm, doch Zwingli verlangte in seiner 2. Züricher Disputation vom 26. bis 28. 10. eine Beseitigung der unnützen Heiligenbilder auf geordnetem Wege durch die Obrigkeit.
Auch forderte der Reformator eine Neuordnung des Gottesdienstes mit der Beseitigung des unbiblischen Messopfers, da in ihm Christus noch einmal neu in unblutiger Weise durch die Hand der Priester für Gott geopfert werde, obwohl doch die Bibel in Johannes 3, Vers 16 genau das Gegenteil erklärt, dass nämlich Gott aus Liebe zur Welt seinen Sohn geopfert hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Zwischen 1523 und 1525 wurde die Kirche in Zürich durch eine Kommission aus Pfarrern und Mitgliedern des Rates Schritt für Schritt weiter reformiert, und diese Reform bedeutete einen radikalen Bruch mit dem katholischen Kultus und der katholischen Verfassung. Nichts wurde beibehalten, was sich nicht aus der Heiligen Schrift begründen ließ.
Zum Schluss möchte ich noch einmal auf den für Zwingli und die Reformation entscheidenden Satz zurückkommen: „Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen.“ Was haben Zwingli und Luther in jener Zeit des Umbruchs für Wahrheit gehalten?
Ihre Leistung liegt vor allem darin, dass sie die Wahrheit des Wortes Gottes wieder entdeckt und somit die einzigartige Bedeutung des Evangeliums erkannt haben, aus dem hervorgeht, dass allein Jesus Christus das Haupt der wahren Kirche ist. Mit der Wahrheit war auch die Freiheit verbunden, und somit wurde die Reformation eine Emanzipationsbewegung von den Fesseln der mittelalterlich katholischen Kirche, die nicht nur die Welt, sondern auch die Unterwelt regieren wollte.
Leider haben auch die Reformatoren meist nur ihre eigenen Positionen als wahr angesehen und nicht zugelassen, dass andere religiöse Gruppen sich frei entfalten konnten, wie z. B. die Täufer, die gerade von der Züricher Reformation grausam verfolgt wurden. So wurde Felix Manz, der Führer der Täuferbewegung, 1527 in der Limmat ertränkt, weil er die Kindertaufe für unbiblisch hielt
Ich schließe mit einem Satz von Sebastian Castellio, der zunächst den Genfer Theologen Johannes Calvin geschätzt hatte. Als dieser jedoch den Spanier Michael Servet, der nicht an die göttliche Dreieinigkeit glauben wollte, in Genf als Ketzer verbrennen ließ, schrieb er 1554 gegen Calvin: „Einen Menschen töten, heißt nicht, eine Lehre verteidigen, sondern einen Menschen töten.“ Castellio vertrat die Auffassung, dass man einen Ketzer nur durch verbale Argumente und nicht mit der Todesstrafe überwinden dürfe: Die Kirche könne gegen abweichende Meinungen nur die von Paulus gemeinten geistlichen Waffen einsetzen.“ Wollen wir Gott danken, dass wir heute zwar in unterschiedlichen, aber doch versöhnten christlichen Konfessionen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen und leben dürfen. Amen
gehalten am 03.08.2025 von Prädikant Dr. Holger Ueberholz in der Gräfrather Kirche