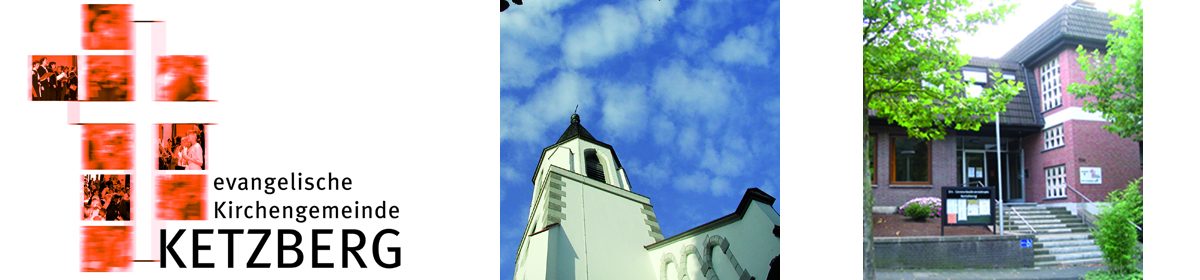Liebe Geschwister, wie politisch darf, kann oder muss die Kirche sein? Diese Frage nach der rechten Aufgabenverteilung zwischen Kirche und Staat war für Dietrich Bonhoeffer ein Lebensthema. Er wurde 1906 in eine Familie hineingeboren, die großbürgerlich und akademisch war und die wichtige Staatsdiener wie Kirchenmänner in ihrem Stammbaum hatte. Dietrich wuchs in der Nachbarschaft mit Professorenkindern und Kindern hoher preußischer Staatsdiener auf. Sein Vater war Mediziner und Universitätsprofessor in Berlin. Zu seinen Vorfahren gehörten staatliche Juristen und staatlich-kirchliche Theologen. Bis zum ersten Weltkrieg war das Landeskirchenamt in Berlin eine preußische Regierungsbehörde. Das Verhältnis zwischen Staat und Kirche galt bei der damals in Berlin dominierenden lutherischen Theologie anders als heute nicht als Gegenüber. Kirche und Staat galten als zwei sich ergänzende Instanzen, durch die Gott die Gesellschaft ordnete. Ein Grundpfeiler dieser Theologie war der Römerbrief des Apostel Paulus. Im 13. Kapitel heißt es dort: „Es gibt keine Obrigkeit außer von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum: Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung.“ Staat und Kirche waren für die lutherische Theologie zwei Seiten der einen Medaille Obrigkeit: Für Zucht und Ordnung sorgte auf der einen Seite der Staat durch Justiz, Militär und Polizei, auf der anderen Seite die Kirche durch die Predigt von Sitte und Moral. Und indem sie darauf verwies, dass staatliches Handeln vorläufig notwendig ist, weil die Welt eben noch nicht das Paradies ist.
Für Dietrich Bonhoeffer war diese Rollenverteilung selbstverständlich, als er sich früh entschloss, Theologie zu studieren. Er war hoch intelligent und fleißig: Mit erst 21 Jahren schloss er das Studium ab: nicht nur mit dem Ersten Theologischen Examen, sondern auch mit seiner Promotion zum Doktor der Theologie. Für ihn gab es jetzt zwei Möglichkeiten: Er konnte entweder an der staatlichen Uni bleiben und wie sein Vater, Großvater und Urgroßvater eine Karriere als Universitätsprofessor anstreben. Oder er konnte sich von der Kirche praktisch zum Pfarrer ausbilden lassen. Dietrich Bonhoeffer entschied sich für – beides: Vikar und wissenschaftlicher Theologe. 1930 machte er dann wieder zwei Abschlüsse: Bei seiner Kirche legte er die Zweite Theologische Prüfung als Voraussetzung fürs Pfarramt ab. Und an der Universität seine Habilitation, also eine große wissenschaftliche Arbeit als Voraussetzung für eine Laufbahn in Lehre und Wissenschaft.
Bonhoeffer hatte es mit 24 schon sehr weit gebracht. Aber fürs Pfarramt musste er mindestens 25 sein. Also entschied er sich für ein Studiensemester an der Theologischen Fakultät in New York. Eher als Notlösung gedacht wurde dieses Jahr für Bonhoeffer prägend. In New York kam er raus aus der gelegentlichen Selbstgenügsamkeit deutscher akademischer Theologie und in Kontakt mit Vertretern der noch jungen weltweiten ökumenischen protestantischen Bewegung. Er lernte dort theologische Überlegungen kennen, die auf der Grundlage der Bibel nicht staatstragend waren, so wie er es aus Berlin kannte, sondern sozialkritisch. Er lernte christlichen Pazifismus kennen. Für ihn als deutschen von der lutherischen Theologie geprägten Theologen war das etwas Neues.
Im ersten Weltkrieg hatten Pfarrer die deutschen Waffen gesegnet. Und als junger Theologiestudent in Tübingen hatte Bonhoeffer selber noch an einer Art Wehrsportübung teilgenommen, wenn er auch mit rechtsnationalen Gedanken wenig anfangen konnte.
Noch als Vikar hatte er in einem Vortrag den Pazifismus abgelehnt und stattdessen den Kriegsdienst theologisch begründet: „Ich werde die Waffe erheben in der furchtbaren Erkenntnis, etwas Entsetzliches zu tun (…), aber die Liebe zu meinem Volk wird den Mord, wird den Krieg heiligen.“ (Bonhoeffer-Auswahl 1, 46). In New York begann Dietrich Bonhoeffer die Grundsätze lutherischer Theologie zum Verhältnis zwischen Kirche und Staat, wie er sie aus Deutschland kennengelernt hatte, infrage zu stellen. Stattdessen sympathisierte er dort erstmals mit pazifistischen Gedanken und träumte sogar davon, nach Indien zu reisen, um dort Gandhi kennenzulernen.
Stattdessen kehrte der 25-Jährige 1931 wieder nach Berlin zurück: Er trat eine Stelle als Dozent an der Berliner Theologischen Fakultät an, arbeitete gleichzeitig als Studentenpfarrer und übernahm auch noch Predigtdienst und Konfirmandenunterricht in einer Berliner Arbeitergemeinde. Als wäre das noch nicht genug, hatte er sich außerdem in ein wichtiges Ehrenamt der weltweiten ökumenischen Bewegung wählen lassen. Hier pflegte er die internationalen Kontakte, die sein weiteres Leben immer stärker prägen würden.
Zuhause an der Berliner Universität erregten seine Vorlesungen Aufmerksamkeit. Nicht nur weil er im Hörsaal die Studenten mit Gebeten überraschte. Sondern vor allem weil Bonhoeffer pazifistische Positionen vertrat, während ein immer größer werdender Teil der evangelischen Theologiestudierenden mit den Nationalsozialisten sympathisierte. In einem Vortrag von 1932 vertrat der akademische Lehrer nun eine ganz andere Auffassung als noch vier Jahre zuvor der Vikar. Er widersprach vehement der inneren Aufrüstung, die im Deutschen Reich längst wieder auf dem Vormarsch war, und verlangte auch von der Kirche klaren Widerspruch: „Der heutige Krieg vernichtet Seele und Leib (…) darum muss der heutige Krieg, also der nächste Krieg, der Ächtung durch die Kirche verfallen.“ (Bonhoeffer-Auswahl 1, 140).
Am 30. Januar 1933 kommt Hitler an die Macht. Die staatliche Obrigkeit, das sind nun die Nazis. Die im März 1933 erlassene Notverordnung des Reichspräsidenten sowie das Ermächtigungsgesetz heben viele Grundrechte der Weimarer Verfassung auf. Der Nazi-Terror gegen politisch andersdenkende und gegen jüdische Menschen hat nun eine rechtliche Basis. Der Großteil der lutherisch geprägten Kirche hat damit allerdings kein Problem. In einer Predigt verleiht der Berliner Generalsuperintendent Otto Dibelius dem Nazi-Terror sogar eine theologische Rechtfertigung: „Wenn es um Leben oder Sterben der Nation geht, dann muss die staatliche Macht durchgreifend und kraftvoll eingesetzt werden (…) Wir haben von Dr. Martin Luther gelernt, dass die Kirche der staatlichen Gewalt nicht in den Arm fallen darf, wenn sie tut, wozu sie berufen ist. Auch dann nicht, wenn sie hart und rücksichtslos schaltet.“
Dietrich Bonhoeffer hingegen denkt angesichts dieses staatlichen Terrors und der staatlichen Unrechtspolitik gegen alle Menschen, die er als „jüdisch“ bezeichnet, darüber nach, welche Aufgaben die Kirche in einem Unrechtsstaat haben kann. In einem später veröffentlichten Vortrag vor Berliner Pfarrern argumentiert er strikt theologisch und benennt drei Handlungsmöglichkeiten für die Kirche:
Erstens habe die Kirche die Pflicht, den Staat kritisch nach der Rechtmäßigkeit seines Handelns zu fragen. Zweitens müsse die Kirche sich um alle Opfer staatlichen Unrechts kümmern, nicht nur ihre um Mitglieder der Kirche. Und wenn die Kirche erkennt, dass der Staat seiner grundlegenden Aufgabe, Recht und Ordnung für alle zu schaffen, nicht mehr nachkommt oder nachkommen will, dann müsse die Kirche schließlich drittens unmittelbar politisch handeln. Also: widersprechen oder sogar widerstehen. In dieser Situation dürfe sich die Kirche um des Schutzes der Opfer willen nicht mehr aus der Politik heraushalten.
Kirche im Widerstand gegen den Staat? Für die allermeisten Theologen klang das unerhört. Selbst in der 1933 und 34 sich gründenden Bekennenden Kirche wollen viele sich nur gegen staatliche Angriffe auf die kirchliche Unabhängigkeit wehren. Nicht aber weil man dem NS-Regime angesichts der unzähligen Menschen, die es aus rassistischen oder politischen Gründen zu Opfer einer Terrorherrschaft macht, entgegentreten wollte. Bonhoeffer sieht sich in seiner Kirche isoliert. Er zieht sich zurück und tritt eine Pfarrstelle in der deutschen Auslandsgemeinde in London an.
Doch Bonhoeffer schöpft noch einmal Hoffnung, dass die Bekennende Kirche sich entschließt, für ihre Vikare eine eigene Ausbildung ohne staatliche Aufsicht zu gründen, um sich nicht mit dem Terrorstaat zu arrangieren. Um so eine Ausbildungsstätte für angehende Pfarrer zu leiten, kehrt der 29-Jährige 1935 aus London zurück. Es gibt Morgen- und Abendandachten, Meditationszeiten, viel theologische Arbeit und zahlreiche Gespräche darüber, was es bedeuten kann, als Pfarrer in einer Kirche zu arbeiten, die nicht staatlichen Regeln, sondern Christus folgt. Bonhoeffers Antwort lautet: Nachfolge bedeutet, kompromisslos nach der Bergpredigt zu leben.
Für Bonhoeffer bedeutet das auch, dass die Kirche dem staatlichen Antisemitismus wider-sprechen und sich für dessen Opfer einzusetzen hätte. Doch diese Haltung teilen selbst in der Bekennenden Kirche längst nicht alle. Der größte Teil der Evangelischen Kirche war sowieso staatstreu oder ganz nationalsozialistisch gesinnt. Der staatliche Druck auf alle Opposition steigt auch in der Evangelischen Kirche. Käme er nicht aus einer gutvernetzten großbürger-lichen Familie, hätte ihn die Gestapo vielleicht schon längst geholt. Da kommt 1939 das Angebot, einen theologischen Lehrauftrag in New York wahrzunehmen. Bonhoeffer reist über den Atlantik. Vielleicht ein Ausweg? Freunde in den USA beschwören ihn, dort in Sicherheit vor den Nazis zu bleiben. Aber es quält sein Gewissen, im Ausland in Sicherheit zu sein, während in Deutschland seine ehemaligen Vikare staatlichem Druck ausgesetzt sind. Er hat das Gefühl, dass Christus ihn in der Heimat braucht. Und reist nach nur einem Monat wieder ab.
Zurück in Deutschland wird Dietrich Bonhoeffer zu einer Art Doppelagent. Über familiäre Beziehungen lässt er sich als Mitarbeiter des Spionagedienstes der Deutschen Wehrmacht anstellen und übernimmt Kurierdienste in ganz Europa. Öffentlich bleibt er Teil der Bekennenden Kirche und der Ökumenischen Bewegung. Letztlich aber hat er sich im Untergrund der Verschwörergruppe angeschlossen, die an einem neuen Deutschland arbeitet und am 20. Juli 1944 das fehlschlagende Attentat auf Adolf Hitler unternehmen wird. Für Bonhoeffer stellt sich nicht mehr die Frage, wie er möglichst unschuldig bleiben kann. Für ihn stellt sich nur noch die persönliche Frage, was größer ist: die Schuld des untätigen Mitansehens oder die Schuld der Mitwirkung an einem Mordkomplott gegen den Tyrannen. Bonhoeffer hat sich entschieden und ist nun Teil des militanten Widerstands gegen Hitler. Die Hoffnung, die Evangelische Kirche zum wirksamen Widerstand gegen das NS-Regime bewegen zu können, hat er aufgegeben.
Fast vier Jahre geht das so. Dann klingelt im April 1943 die Gestapo. Aber von der Verschwörung, an der Bonhoeffer beteiligt ist, wissen sie noch gar nichts. Es geht um ein paar minder schwere Vorwürfe, aber richtig Verwertbares hat die Gestapo gegen Bonhoeffer zu dem Zeitpunkt gar nicht in der Hand. Als die brutalen Verhöre der ersten Tage nichts Verwertbares ergeben, werden seine Haftbedingungen wieder gelockert: Er kann im Tegeler Gefängnis bald regelmäßig Besuch empfangen, Briefe austauschen, sich mit Literatur versorgen lassen. Und er hofft, dass die anderen Verschwörer draußen ihre Arbeit endlich vollenden und das Nazi-Regime beseitigen können. Von seiner Kirche dagegen erwartet er gar nichts mehr. Im Mai 1944 schreibt er an einen Freund: „Unsere Kirche, die in diesen Jahren nur um ihre Selbsterhaltung gekämpft hat, als wäre sie ein Selbstzweck, ist unfähig, Träger des versöhnenden und erlösenden Wortes für die Menschen und für die Welt zu sein (…) Unser Christsein wird heute nur in Zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des Gerechten.“ (WuE, S. 328)
Am 20. Juli 1944 scheitert das Attentat auf Hitler. Viele Verschwörer werden hingerichtet. Einige Wochen später findet die Gestapo Unterlagen, die Bonhoeffers Verstrickung in die Verschwörung zeigen. Er kommt in den berüchtigten Keller des Reichssicherheitshauptamtes. Die Haftbedingungen sind dort viel schärfer. Nur noch zwei Briefe erreichen danach die Familie. In einem schickt er seinen Silvestergruß mit den berühmten Worten „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Im Frühjahr 1945 werden Bonhoeffer und Mitgefangene nach Süden verlegt. Am 5. April befiehlt Hitler, die letzten Mitglieder der Verschwörergruppe umzubringen. Dazu gehört auch Bonhoeffer. Am 8. April hält er auf Wunsch seiner Mitgefangenen noch einmal eine Andacht. Am frühen Morgen des 9. April wird Dietrich Bonhoeffer einen Monat vor Kriegsende im bayerischen KZ Flossenbürg erhängt. Er wird nur 39 Jahre alt.
Wie politisch darf, kann oder muss also die Kirche sein? Die Antwort Bonhoeffers: Eine Kirche hat sich nicht um ihre Privilegien oder ihre eigenen Rechte zu kümmern. Sie hat sich auch nicht aus der Politik herauszuhalten. Sondern sie muss den Staat um Christi willen danach fragen, ob er überhaupt seine Daseinsberechtigung erfüllt: nämlich allen ein sicheres, menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.
Ich finde, das muss auch heute der Maßstab sein, wenn sich Kirche zu Wort meldet. Kirche darf sich nur dann als Kirche Jesu Christi verstehen, wenn sie im Sinne Jesu für die geringsten Brüder und Schwestern eintritt und sich lautstark auch für deren Würde einsetzt. In diesem Sinne muss sie auch heute manchmal politisch sein.
Bonhoeffer lehrt uns aber auch, dass Kirche nie parteipolitisch werden darf. Darum darf sie ihre Äußerungen und Einmischungen nicht von irgendwelchen parteipolitischen Programmen oder Konzepten ableiten, sondern allein von dem, was sie nach gründlicher theologischer Arbeit in Christi Namen sagen zu müssen glaubt. Und sie muss klar erkennbar machen, dass sie nichts anderes tut. Manchmal macht das Politik in der Kirche nötig. Manchmal unmöglich.
Und Dietrich Bonhoeffer zeigt uns schließlich, dass es nicht nur um die Frage geht, wie politisch die Kirche sein darf, sondern auch um die Frage, wie politisch ich als einzelner Christenmensch vielleicht werden muss. Wie politisch oder unpolitisch die Kirche spricht oder handelt, befreit mich nicht aus der Verantwortung zu entscheiden, wo ich um Christi willen selbst politisch handeln muss. Diese Entscheidung kann ziemlich schwer sein. Dazu kann ich das Gespräch mit Gott suchen. Und wenn mich dieses Gespräch dann zu einem Ergebnis führt, muss ich ggf. handeln. Einfach raushalten, womöglich nur darüber schwadronieren, was andere, die Politik oder die Kirche, besser tun sollten, ist keine Option. Nicht nur für die Kirche insgesamt, sondern auch für uns Christenmenschen als Einzelne geht es in der Politik immer um zweierlei: ums Beten und ums Tun des Gerechten. Amen.
gehalten von Pfarrer Thomas Förster am 10.08.2025 in der Gräfrather Kirche